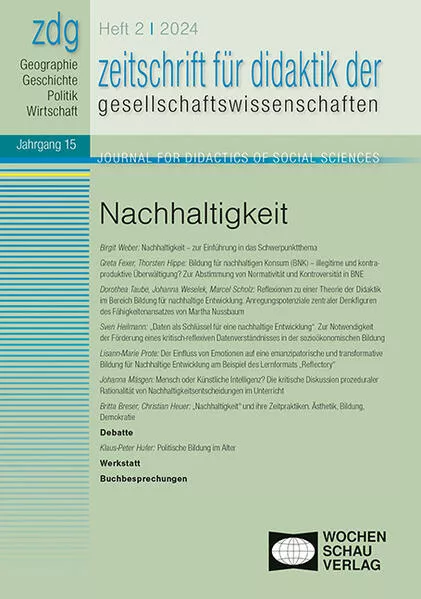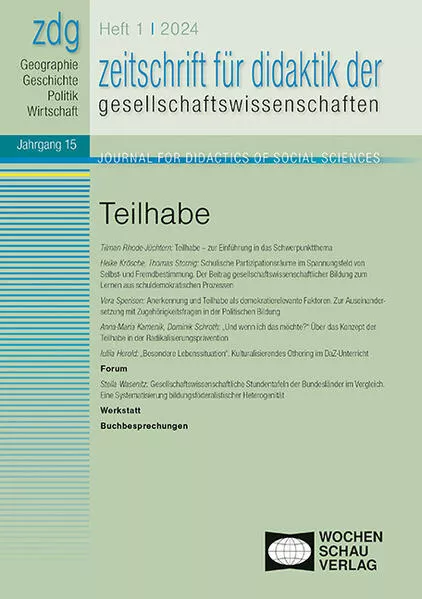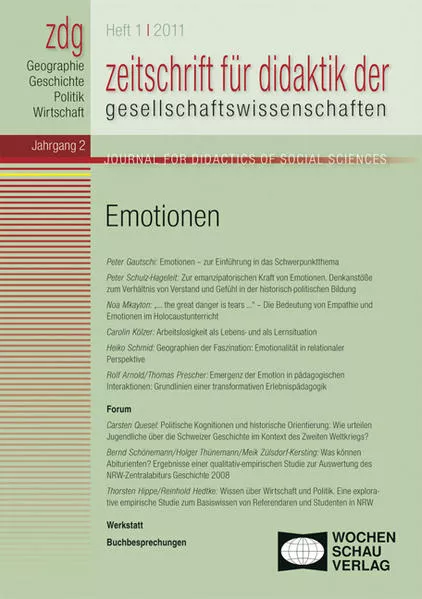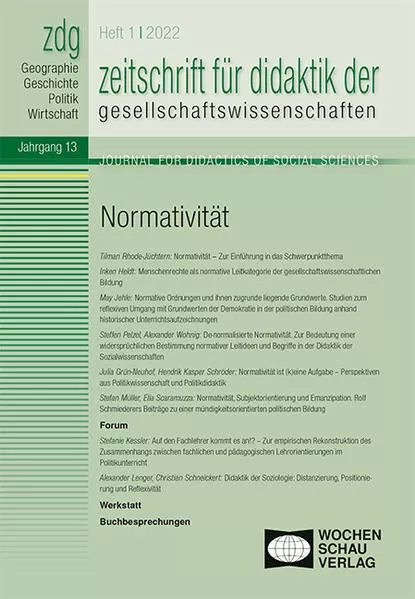- Publikationen ca: 4
- Fragen & Antworten
Peter Gautschi
Dr. Inken Heldt ist Juniorprofessorin für die Didaktik der Politischen Bildung an der Universität Kaiserslautern, aktuell vertritt sie die Professur für Fachdidaktik Gemeinschaftskunde an der Universität Leipzig.
Dr. May Jehle ist wissenschaftliche Mitarbeiterin an der Professur für Didaktik der Sozialwissenschaften mit dem Schwerpunkt politische Bildung an der Goethe-Universität Frankfurt/M.
Florian Johann (M. Ed.) ist Lehrer der Fächer Geographie und Biologie und aktuell als wissenschaftlicher Mitarbeiter in der Abteilung Geographie am Institut für Integrierte Naturwissenschaften an der Universität Koblenz-Landau (Campus Koblenz) tätig.
Dr. Stefanie Kessler ist Professorin für Soziale Arbeit an der IU Internationalen Hochschule im Dualen Studium am Studienort Braunschweig.
Dr. Alexander Lenger ist Professor für Soziologie an der Katholischen Hochschule Freiburg.
PD Dr. Stefan Müller ist Privatdozent für Didaktik der Sozialwissenschaften an der Justus-Liebig-Universität Gießen.
Steffen Pelzel ist wissenschaftlicher Mitarbeiter der Didaktik der Sozialwissenschaften an der Universität Siegen, Philosophische Fakultät.
Elia Scaramuzza ist wissenschaftlicher Mitarbeiter und Promovend am Arbeitsbereich Didaktik der politischen Bildung an der Johannes Gutenberg-Universität Mainz.
Dr. Christian Schneickert ist Vertretungsprofessor für Soziologie an der Otto von Guericke Universität Magdeburg.
Dr. Hendrik Kasper Schröder ist Lektor für Politikwissenschaft und ihre Didaktik an der Universität Bremen.
Dr. Alexander Wohnig ist Professor für Didaktik der Sozialwissenschaften an der Universität Siegen, Philosophische Fakultät.
Nachhaltigkeit
Birgit Weber: Nachhaltigkeit – zur Einführung in das SchwerpunktthemaSchwerpunktGreta Fexer, Thorsten Hippe: Bildung für nachhaltigen Konsum (BNK) – illegitime und kontraproduktive Überwältigung? Zur Abstimmung von Normativität und Kontroversität in BNEDorothea Taube, Johanna Weselek, Marcel Scholz: Reflexionen zu einer Theorie der Didaktik im Bereich Bildung für nachhaltige Entwicklung.
Teilhabe
Teilhabe ist ein Schwergewicht unter den Begriffen zur Theorie und Praxis der Demokratie. Einerseits ist Teilhabe die hohe Schule einer aktiven Gesellschaft, andererseits liegt hier ein Feld der „Demophobie“.Die Beiträge in dieser Ausgabe der zdg befassen sich mit Schule als Partizipationsraum, Anerkennung und Zugehörigkeit, Recht auf Radikalisierung, „Othering“ beim Deutsch-Sprachunterricht und Multiperspektivität.
ZDG 1/2011, Emotionen
Emotionen Emotionen – zur Einführung in das Schwerpunktthema Zur emanzipatorischen Kraft von Emotionen. Denkanstöße zum Verhältnis von Verstand und Gefühl in der historisch-politischen Bildung „. the great danger is tears.“ – Die Bedeutung von Empathie und Emotionen im Holocaustunterricht Arbeitslosigkeit als Lebens- und als Lernsituation Geographien der Faszination: Emotionalität in relationaler Perspektive Emergenz der Emotion in pädagogischen Interaktionen: Grundlinien einer transformativen Erlebnispädagogik Forum Politische Kognitionen und historische Orientierung: Wie urteilen Jugendliche über die Schweizer Geschichte im Kontext des Zweiten Weltkriegs? Was können Abiturienten? Ergebnisse einer qualitativ-empirischen Studie zur Auswertung des NRW-Zentralabiturs Geschichte 2008 Wissen über Wirtschaft und Politik.
Normativität
Normativität ist ein sozialwissenschaftlicher Schlüsselbegriff, der als Beschreibung, als Norm und als Gebot auftauchen kann. Gesinnung und Interesse, Objektivität, Diskurs und mediale Verkündung müssen sorgsam reflektiert werden.Die zdg 1/22 enthält die Erinnerung an den Werturteilsstreit und den Beutelsbacher Konsens, reflektiert differente Logiken von Sach- und Werturteil, Handlungsorientierung zur Mündigkeit und Partizipation, bildungstheoretische und fachdidaktische Konzepte sowie die Rolle der Lehrenden.