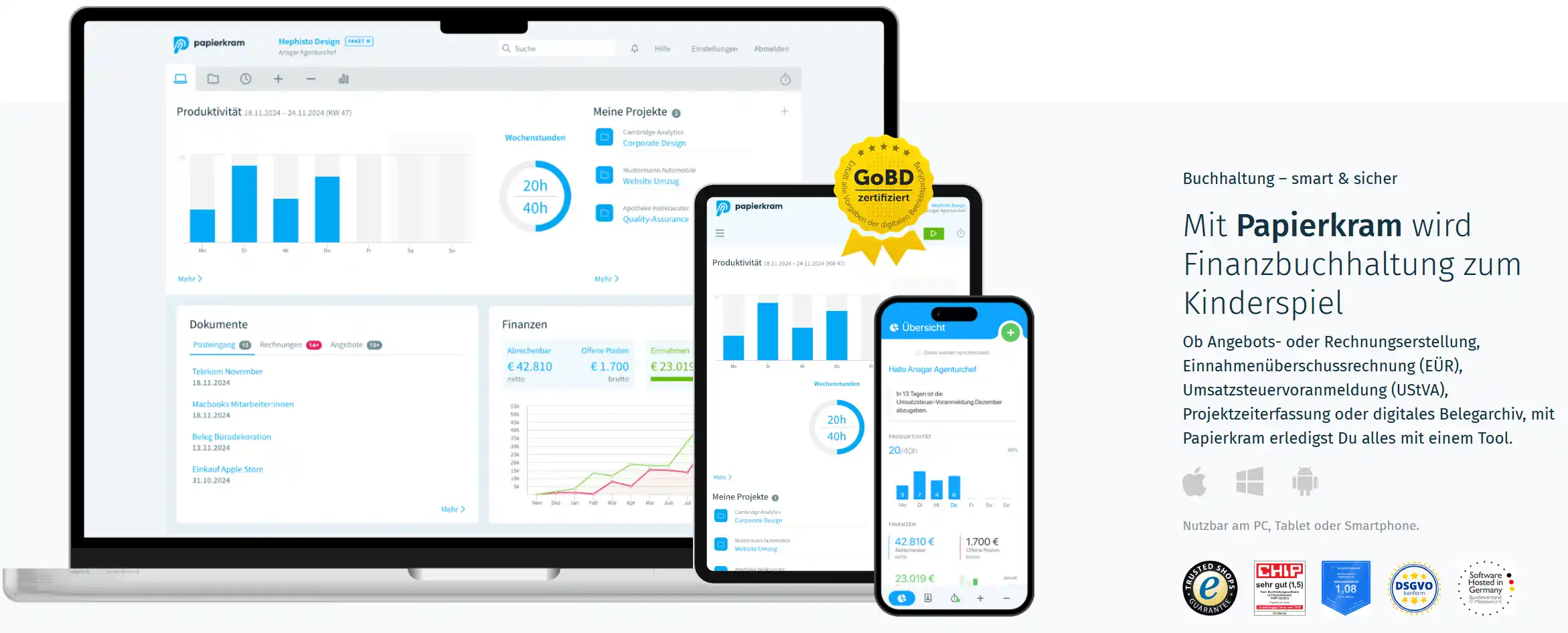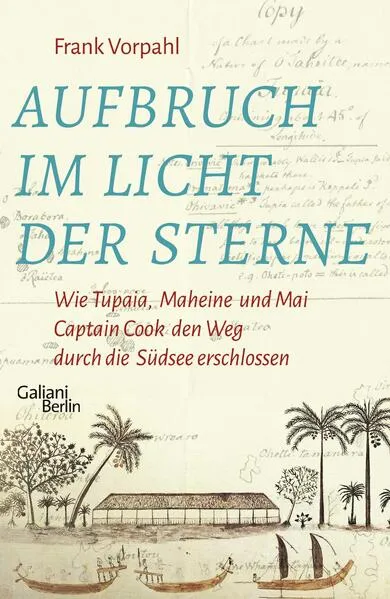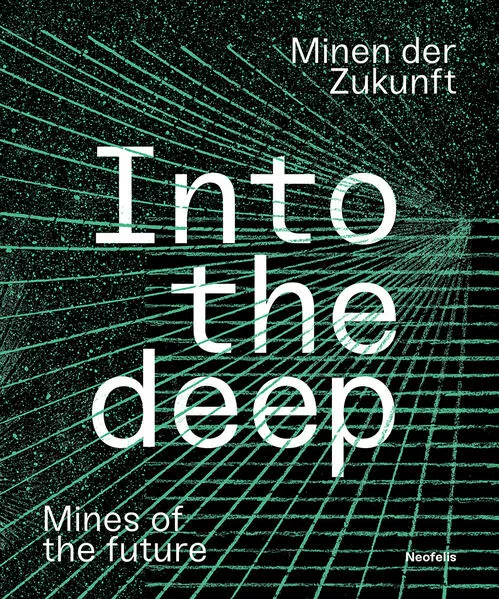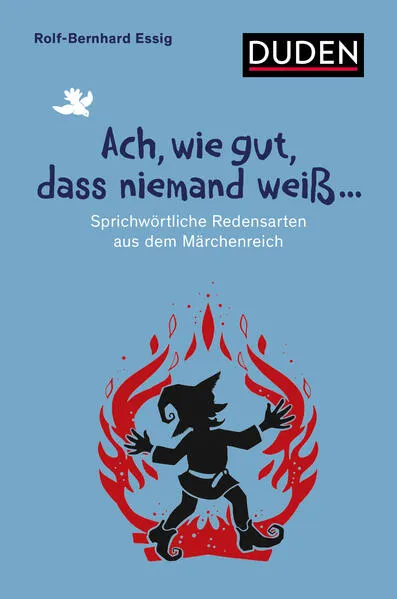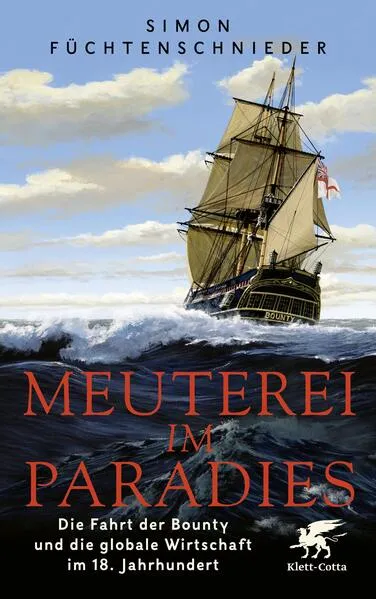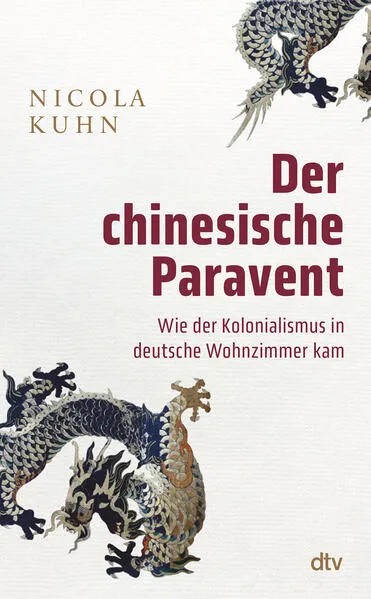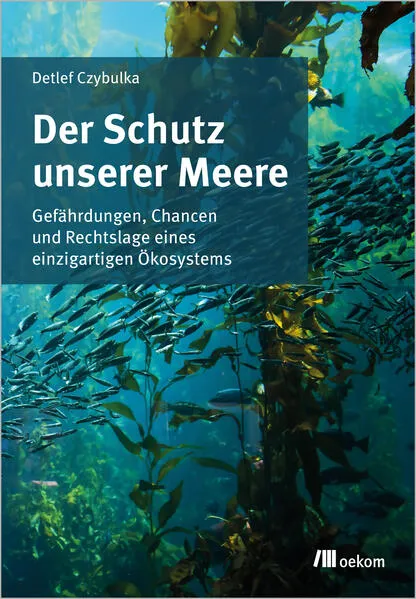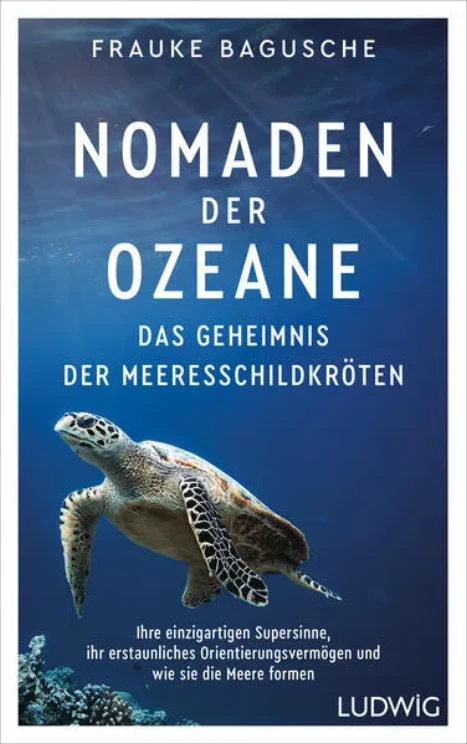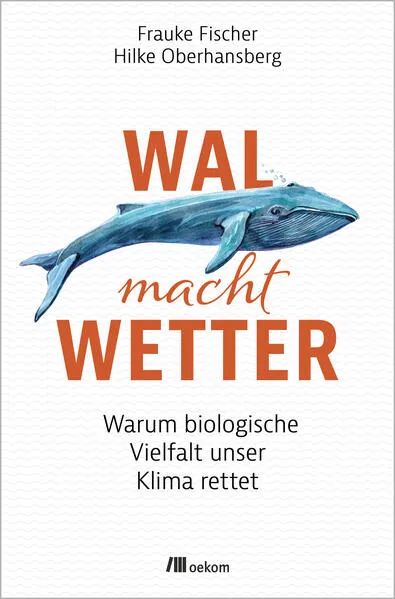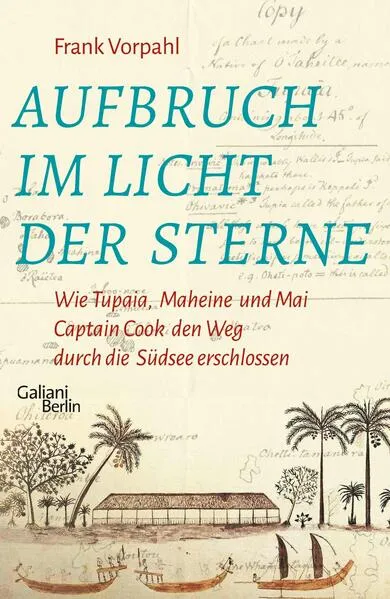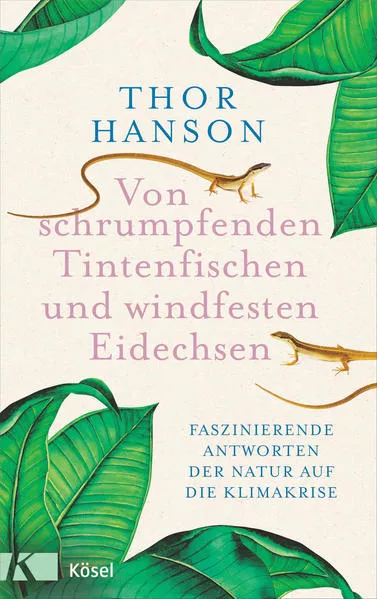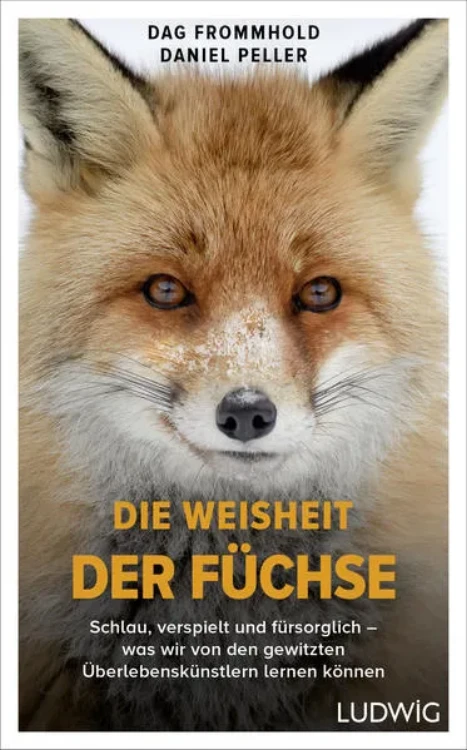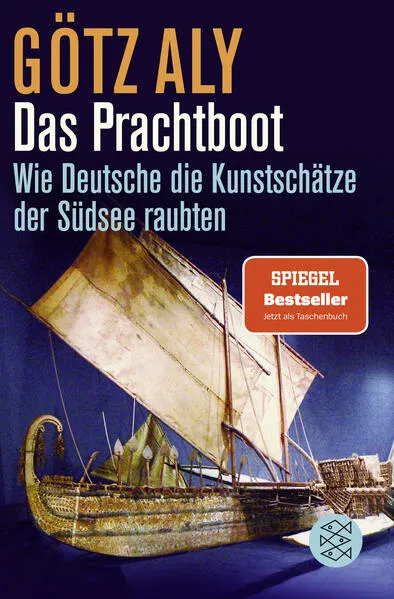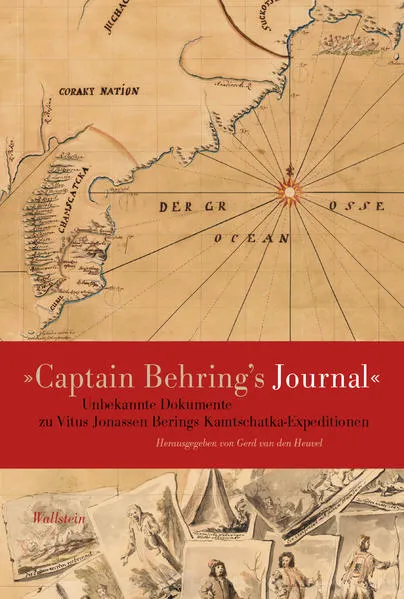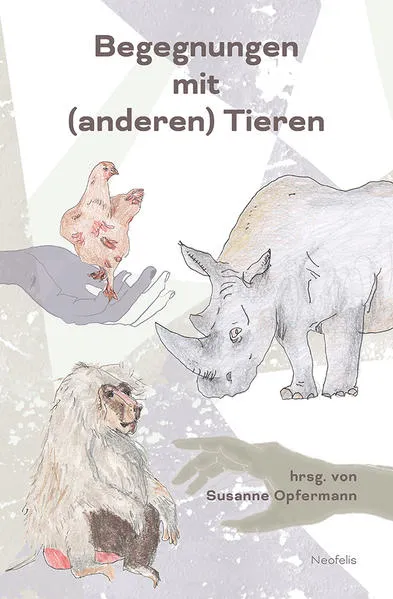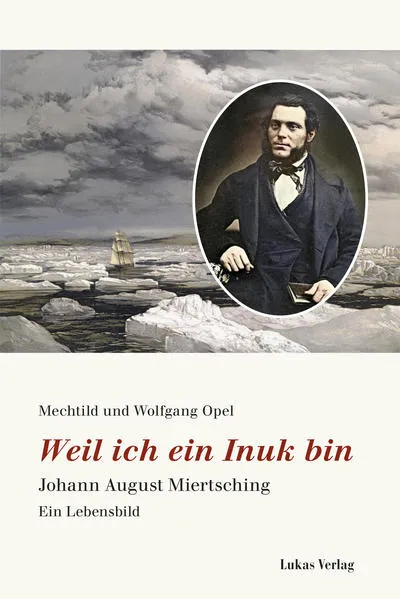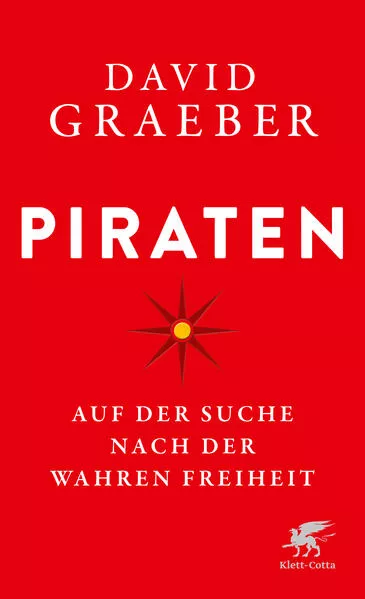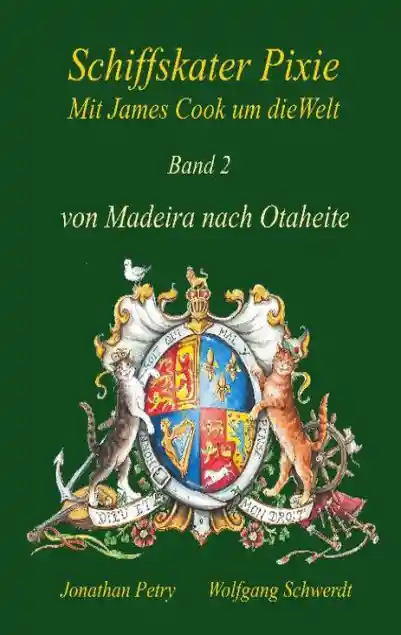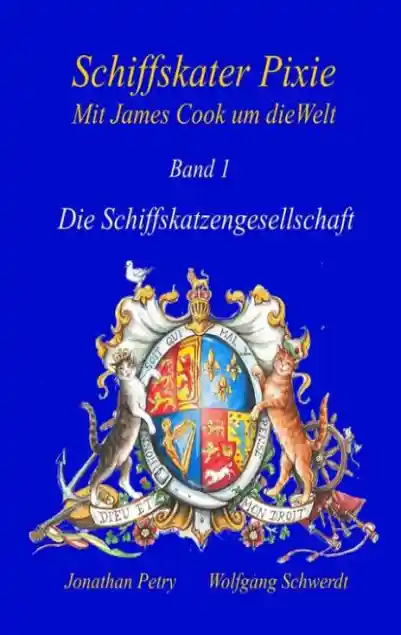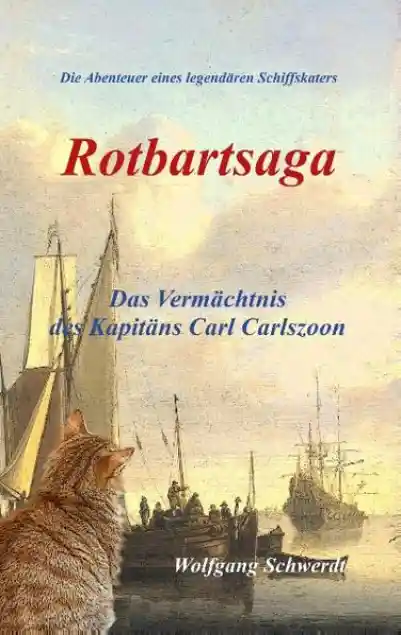Die Erfindung des Rades
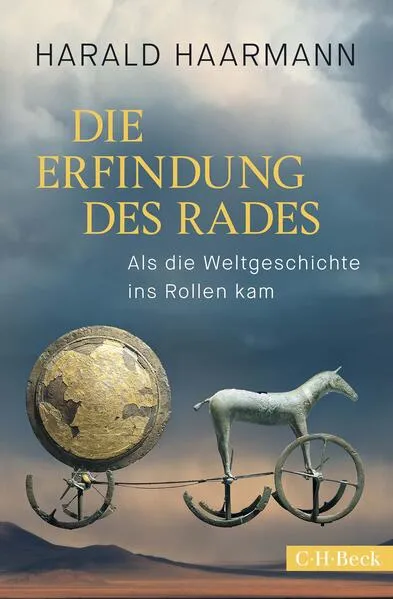
Das Rad gilt als eine der wichtigsten Erfindungen der Menschheit, gleichzusetzen mit dem Gebrauch des Feuers, der Metallverarbeitung und der Schrift. Mit dieser Feststellung folgt der Kulturwissenschaftler Harald Haarmann der konventionellen technologie- und herrschaftsorientierten Geschichtsbetrachtung, die sich auch im Untertitel seines Buches „Als die Weltgeschichte ins Rollen kam“ niederschlägt. Dabei greift er neuere Forschungsergebnisse hinsichtlich der Ursprünge der Radtechnologie auf und verortet die „Erfindung“ des Rades in zwei Zentren: der alteuropäischen Donauzivilisation und der mesopotamischen Zivilisation im Mittleren Orient.
Die ersten Räder
Natürlich ist die „Erfindung“ des Rades oder besser, die Anwendung des Scheibe-Achse-Prinzips eine recht komplexe Angelegenheit, die nur wenig mit den Prozessen „technologischer Innovation“ im heutigen Sinne zu tun hat. Und so hat „man“ das Rad auch nicht gezielt als Lösung eines Mobilitäts- oder Transportbedürfnisses „erfunden“, sondern es entwickelte sich, wie archäologische Funde belegen, lange vor seiner Anwendung am Wagen in der Keramikproduktion. Die drehbare Töpferscheibe gilt als die primäre Innovation in Bezug auf die Radtechnologie, die sich erst Jahrtausende später in Wagen als Transportmittel und den legendären Streitwagenheeren der Großreiche niederschlug. Und so ist auch das erste Kapitel der Erfindung des Töpferrads in Europa und dem Mittleren Osten gewidmet.
Und wer hat‘s erfunden?
In der eurasischen Kontaktzone von Ackerbauern und Steppennomaden lassen sich im 4. Jahrtausend die ältesten Experimente mit Rad und Achse nachweisen. In diesem Kapitel präsentiert Haarmann neben der Entwicklung vom Scheibenrad zum Speichenrad auch das Spektrum der Zugtiere, die für die anfangs schweren, klobigen Gefährte eingesetzt wurden. Neben Ochsen Esel und Pferden, die für den eurasischen Raum charakteristisch sind, wurden beispielsweise in China, dass die Radtechnologie wohl von eurasischen Steppennomaden adaptiert hatte, Wasserbüffel angespannt. Kamele sind als Zugtiere aus Zentralasien nachgewiesen und aus der Mongolei ist ein Felsenbild bekannt, auf dem ein zweirädriger Karren von einem Rentier oder Hirsch gezogen wird. Der Geschichte des Wagens und seiner Verbreitung geht der Autor auch sprachlich auf den Grund. Dabei verortet er die frühe Spezialterminologie der Radtechnologie im proto-indoeuropäischen Grundwortschatz. Später auch als eigenständige Terminologie im Alteuropäischen.
Machtfaktor Streitwagen
Der Verbreitung von Rad und Wagen aus dem euroasiatischen Kerngebiet über die alte Welt bis nach China widmet sich das dritte Kapitel und im vierten Kapitel „Die Ära der Streitwagen“ landet der/die LeserIn schließlich dem gefühlten Hauptteil des Buches. Da geht es um Streitwagenschlachten, und Kampfwagenkonzepte, um Wagenlenker und Pferdeausbildung und Produktionsstätten sowie die Folgen des kriegerischen Mobilitätsschubes für die Machtkonstellationen der vorderorientalischen und ägyptischen Großreiche. Verbunden waren die Streitwagenkulturen mit einer mythologischen Überhöhung des zweirädrigen Herrschaftsinstruments, insbesondere in der griechischen Welt, dessen Symbolkraft sich bis in die jüngste Zeit vor allem in der europäischen Welt erhalten hat.
Religiöse Bedeutung
Doch auch in den Riten, Religionen, Mythologien und Philosophien anderer Kulturen hat die Radsymbolik einen zentralen Stellenwert eingenommen. Selbst dort, wo das Rad nie praktische Anwendung fand, wie beispielsweise bei den Maya, war das Rad in vielfältiger Funktion fester Bestandteil der mythologisch-religiösen Sphäre. Anders bei den anderen indigenen amerikanischen Kulturen, bei denen das Rad weder mythologisch noch praktisch eine Rolle spielte. Die Erklärung hierfür ist kurz und folgt dem klassischen Muster der Besonderheiten des unwegsamen Landes und des Fehlens geeigneter Zugtiere. Nach meinem Dafürhalten ein wenig oberflächlich, denn, wie Kapitel 7 „Wege und Straßen“ zeigt, bauen die Menschen bei entsprechendem Willen eben geeignete Wege und ob in der aus europäischer Sicht „Neuen Welt“ beispielsweise mit Lamas geeignete Zugtiere verfügbar gewesen wären, lässt sich naturgemäß nicht zuverlässig feststellen. Schließlich waren auch Esel, Rentiere, und die Altweltverwandten der Lamas, die Kamele, nicht als Zugtiere geboren.
Die „Modernisierung“ der Welt
Aber wie auch immer, unsere europäische Technologie mit ihrem Produktions- und Zerstörungspotential wäre ohne das Rad kaum denkbar gewesen. Und insofern passt der Untertitel des Buches aus eurozentrischer Sicht. Denn ohne Einsatz der Radtechnologie wäre die europäische globale Expansion, die überlegene Kriegsmaschinerie, die Industrialisierung kaum gelungen. Deutlich wird dies in Kapitel 8 „Räderwerke: Auf dem Weg ins Maschinenzeitalter“. Das beginnt mit den antiken und mittelalterlichen Rammböcken und Belagerungstürmen auf Rädern und führt zur archimedischen Schraube, deren Vorläufer mutmaßlich Anwendung im Bewässerungssystem für die hängenden Gärten der Semiramis fanden. Göppel, Getriebe und Zahnräder lieferten die Basis für unzählige Anwendungen in Energie- und Rohstoffgewinnung oder in der Zeitrechnung. Im rund einseitigen Epilog liefert der Autor schließlich einen Ausblick in die Zukunft und konstatiert: „Die Modernisierung der Welt wird immer von einer multifunktionalen Radtechnologie geprägt bleiben.“
Harald Haarmann: Die Erfindung des Rades. Als die Weltgeschichte ins Rollen kam. C.H.Beck 2023, Hardcover 191 Seiten.
Wolfgang Schwerdt
Blogger bei LeseHitsBücher zu Kulturgeschichte, Seefahrt, Mensch-Tier-Studien und me(h)er.
Kommentare
Die Erfindung des Rades
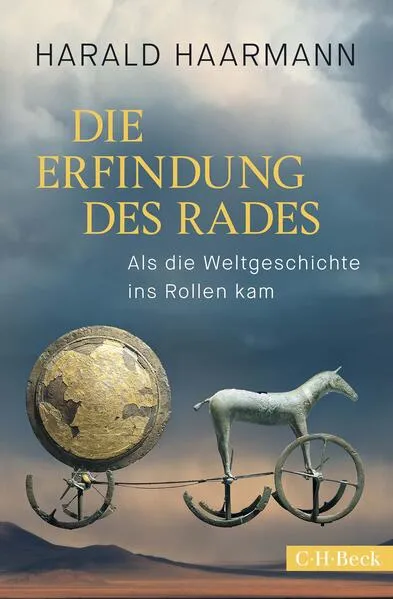 ALS DIE WELTGESCHICHTE INS ROLLEN KAM - DER SIEGESZUG EINER ERFINDUNG
ALS DIE WELTGESCHICHTE INS ROLLEN KAM - DER SIEGESZUG EINER ERFINDUNG
Räder und Wagen sind erstaunlich junge Errungenschaften. Der Kulturwissenschaftler Harald Haarmann erklärt anhand neuerer Funde und Forschungen, warum die bahnbrechende Erfindung eher in Alteuropa und der Eurasischen Steppe nicht im Zweistromland zu verorten ist und wie sie sich von hier aus in der Alten Welt verbreitet hat. Als religiöse Symbole zeugen Räder und Wagen bis heute davon, wie tiefgreifend sie die frühen Hochkulturen geprägt haben.
Als man in Alteuropa, Ägypten und Mesopotamien längst Städte baute, Hochöfen betrieb und schreiben konnte, wurden Lasten noch von Eseln, Kamelen und Menschen geschleppt oder als Gipfel der Technik auf Schlitten durch den Sand und über rollende Stämme gezogen. In den südamerikanischen Hochkulturen gab es überhaupt keine Räder. Harald Haarmann zeigt zunächst, wie um 5000 v. Chr. in der Donauzivilisation das Töpferrad erfunden wurde. Es sollte noch einmal rund tausend Jahre dauern, bis in der Eurasischen Steppe in einer hochmobilen Gesellschaft und einem geeigneten Gelände erstmals Wagen aufkamen. Von hier aus verbreitete sich die Innovation schnell in alle Himmelsrichtungen: nach Europa, Mesopotamien, Indien und China. Um 2000 v. Chr. begann die Ära der Streitwagen, mit denen sich weite Räume beherrschen ließen. Es war die Blütezeit der altorientalischen Großreiche. Die Verdrängung der Streitwagen durch hochmobile Reitereien konnte den Siegeszug des Rades nicht aufhalten: Transportwagen, Schöpfräder, Spinnräder und Zahnradgetriebe haben die Welt verändert und tun das bis heute.
- Die wichtigste Erfindung der Menschheit und warum sie so relativ jung ist
- Neue archäologische Erkenntnisse zur Herkunft des Rades aus der Eurasischen Steppe
- Wie das Rad neue Weltreiche entstehen ließ, den Handel beflügelte und zum mächtigen Symbol in Philosophie und Religion wurde
- Mit zahlreichen farbigen Abbildungen
Beck Paperback
Dieses Buch gehört zu der Reihe
»Beck Paperback« und umfasst derzeit etwa 188 Bände.